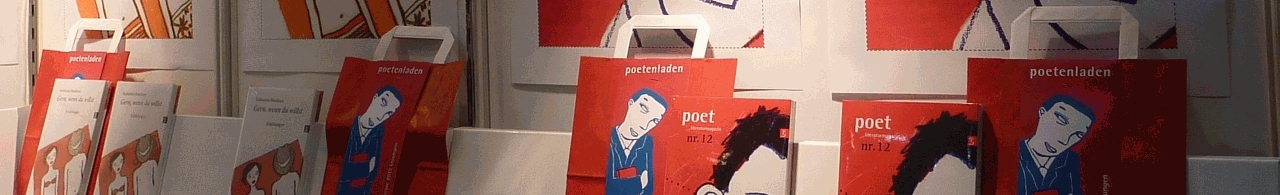Gegend, Gestalt, Geschichte
Zum Band »Verschlissenes Idyll« von Marit Heuß
Aus dem Nachwort von Jan Kuhlbrodt
Marit Heuß legt mit Verschlissenes Idyll einen gründlich durchkomponierten Gedichtband vor, in dem sich Langgedichte und kürzere Formen zu einer Art Vexierbild verschränken. In größeren epischen Entwürfen spiegeln sich blitzlichtartig Momente einer vergänglichen Aktualität. Historische Charaktere werden gegenwärtig:
»in der Fabrik, hatten wir erzählt, wohnte eine Schreckensfamilie,
beschuht mit all den Lederimitaten, Geschöpfe kompliziertester Arbeit,
die dort übriggeblieben waren, Untote, denen vom Leimgeruch
der Realitätssinn schwand, an den Hieroglyphen noch festhielten,
die ihnen ihr Traumzeug von früher war«
In den Bildern von Caspar David Friedrich, die romantische Landschaften zeigen, verschwindet der Mensch, wird gewissermaßen ins Innere der Gegend gezogen, und er taucht zuweilen als Betrachter, als Staffage wieder auf. Noch ist er Spielball der Elemente. Noch scheint ihm das Natürliche unermesslich.
Aber diese romantische Melancholie ist auch eine des sich ankündigenden, des schon ahnbaren Verlustes. Das Anthropozän ist noch kein Begriff, doch die Umwälzungen sind schon im Gange. Die Dampfmaschine ist erfunden und die ersten Eisenbahngleise wurden verlegt. Und bald werden die Züge Touristen nach Italien bringen, oder auch nach Portugal. Die Welt wird schrumpfen und überzogen sein von einem Geflecht aus Bahngleisen und Eisenbahnen. Dem Geflecht, durch das wir heute leben, unter dem wir heute leben. Ein Geflecht, in dem Geschichte zum Bild gerinnt, aber auch von Bildern überlagert wird. Sie schieben sich übereinander und geben punktuell narrative Strukturen wieder frei.
Mit den Gedichten von Marit Heuß finden wir uns also am Ende dieses Prozesses, der sich bei Friedrich als Ahnung zeigt, der Verlust ist manifest und die Landschaften sind geschleift und mit Schächten durchzogen. Das Idyll ist nurmehr Abglanz einer Postkarte oder eben eines Gemäldes des frühen neunzehnten Jahrhunderts. Beides findet sich als Artefakt, aber auch als Bruchstück einer Erinnerung und bildet die entsprechenden lyrischen Formen aus. Damit entbirgt es sich als Gegenwart.
Im Gedicht
Kurbad heißt es:
»Wir stemmen uns gegen das Panoramaglas,
barmherziger die Hügelkreise um uns her,
Hügel, von unsichtbarer Hand künstlich gebildet«
Wie Kapillaren transportieren die Schächte jetzt Mythen und Rohstoffe in die letzten Winkel. Und das ist vielleicht die Kehrseite des Prozesses, der in den Gedichten auf einzigartige Weise auch sichtbar wird.
Die klassische Italiensehnsucht hat ausgespielt, wir sind lange in Rom gewesen, und direkt neben Rom liegt die mitteldeutsche Kleinstadt Beucha mit dem dortigen Steinbruch, der ein Negativabdruck des Monuments ist, das in Leipzig an die Völkerschlacht erinnert. Denn hier wurde der Stein gebrochen, aus dem es besteht.
Und hinter diesem Prozess wird ein anderer sichtbar: Die Welt zu durchwandern ist nicht mehr Privileg nur weniger Wohlhabender. Demokratie dringt ein in die Landschaft, Natur und Geschichte verschmelzen. Das, was Natur war, ist zur Speichergegend geronnen. Und hinter der Melancholie lauert Erkenntnis. Wir begegnen uns selbst in verschiedenster Gestalt. Diese Ambivalenz trägt die Gedichte des Lyrikdebüts von Marit Heuß.